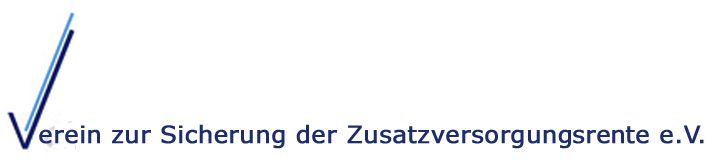Den Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst wurde bis 2001 gemäß dem seit 1967 geltenden Altersversorgungstarifvertrag versprochen, dass sie eine beamtenähnliche endgehaltsbezogene Versorgung mit einer Dynamik der Rente analog zu den Pensionären erhalten würden. Dies ist z. B. sowohl für die länger lebenden Frauen als auch Witwen besonders wichtig, die ansonsten am Ende ihres Lebens im Alters- oder Pflegeheim öffentliche Mittel in Anspruch nehmen müssten, weil sie unterversorgt sind.
Ab 2001 wurde für in der Privatwirtschaft Beschäftigte in §16 BetrAVG geregelt, dass statt einer Anpassungsüberprüfung (zum Ausgleich der Geldentwertung) eine unveränderliche jährliche Anpassung der Versorgung von nur 1% erfolgen darf, um sich arbeitgeberseits einer derartigen Anpassungspflicht zu entledigen. Ohne jede sachliche Notwendigkeit übernahmen die Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst (ver.di, dbb, GEW) diese privatwirtschaftliche Regelung, obwohl im öffentlichen Dienst von Bund, Ländern und Kommunen ja kein Insolvenzrisiko besteht.
Gemäß Altersversorgungstarifvertrag wurde also für die gesamte Rentenlaufzeit ab 2002 die „Dynamik“ der Zusatzversorgungsrente auf jährlich 1% begrenzt. Die Zusatzversorgungskassen setzten diese Regelung für mehr als 2 Millionen Rentner und deren Angehörige im öffentlichen Dienst in ihrer jeweiligen Satzung um. Groß ist die Verärgerung der mehr als 2 Millionen Rentner und ihrer Angehörigen (z. B. Witwen), denn es entsteht – verglichen mit Aktiven und Pensionären und auch mit den Altersbezügen ausgeschiedener Bundestagsabgeordneter, die entsprechend den
durchschnittlichen tariflichen Entgelten angehoben werden – eine ständig zunehmende Unterversorgung.
Schon die für Jahrzehnte von 2002 bis 2025 festgeschriebene Bindungszeit des Altersversorgungstarifvertrages ist zu kritisieren, womit erst 2025 eine
Kündigungsmöglichkeit besteht. Eine Regelung zur Dynamik über eine derart lange Zeit festzuschreiben, obwohl für die Aktiven wegen der laufenden Änderung der wirtschaftlichen Situation ansonsten kurze tarifliche Laufzeiten gelten, ist unverständlich und rechtsmissbräuchlich angesichts der damals (2001/2002) vorhandenen und zukünftig der EZB nach zu erwartenden Inflationsraten von jährlich rund 2%. Nach der Erfahrung aus der Vergangenheit, dass durchaus Geldentwertungsraten von 5% und 6% eintreten können, ist eine derartig lange Bindungsfrist über 24 Jahre bis zu einer eventuellen Kündigung 2025 unbegreiflich. Die Rechtfertigung,
man wolle damit länger lebende höher Verdienende im kapitalgedeckten Modell besonders treffen, ist absurd: Zum einen besteht bei der größten Zusatzversorgungskasse, der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), und städtischen Versorgungskassen auf Jahre hinaus keine Kapitaldeckung; die VBL und zahlreiche weitere Zusatzversorgungskassen werden weiterhin im Umlagesystem geführt. Zum anderen trifft es nicht die wenigen höher Verdienenden, sondern in großer Zahl länger lebende Frauen und insbesondere Witwen mit entsprechender Altersarmut.
Aufgrund der Tarifbewegungen steigen zudem die Einnahmen der Versorgungskassen; bei der VBL wurde sogar durch die 31. Satzungs-änderung mit Wirkung ab 2023 der Umlagesatz um rund 1% abgesenkt und auf die Erhebung von Sanierungsgeld verzichtet. Beides entlastet die aktiven Arbeitnehmer und die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst um jährlich mehr als 600 Millionen Euro. Für eine Erhöhung der laufenden Renten im öffentlichen Dienst sind also aufgrund der Tariferhöhungen bei den Aktiven genug Einnahmen vorhanden. Volkswirtschaftlich ist ein Kürzungsprogramm bei den Rentnern extrem kontraproduktiv, da es sich negativ auf die Binnennachfrage auswirkt: Bekanntlich läuft jeder ausgegebene Euro etwa zehnmal in der Volkswirtschaft um und erzeugt eine entsprechende Binnennachfrage. Ein Kapitalaufbau durch Einsparungen bei den Rentnern – die ihr Geld vornehmlich im Inland ausgeben – ist durch Verminderung der Binnennachfrage extrem konjunkturschädlich.
Seit 2015 stagniert die Lebenserwartung in den Industrieländern, zu denen auch Deutschland zählt. Die Horrorannahmen von 2001 haben sich daher in der gesetzlichen Rentenversicherung und bei der VBL als vorsätzlich in die Welt gesetztes Gespenst erwiesen. Schon die Versorgungsberichte der Bundesregierung korrigierten nachträglich die Werte des Phantom-Rentnerbergs immer weiter nach unten (vgl. Fischer/Siepe: 80 Jahre Zusatzversorgung der VBL, Göttingen 2014, Seiten 28 bis 36, mit besonderer Benachteiligung des Abrechnungsverbandes Ost (S. 33/34)). Insbesondere die 1998 beschlossene Heraufsetzung der Regelaltersgrenze durch das Rentenreformgesetz (RRG), das unter der Schröder-Regierung unangetastet blieb, hat sich ausgewirkt und die weitere Heraufsetzung der Altersgrenze auf das 67. Lebensjahr verkürzt die Rentenbezugszeit noch weiter und trägt zur Entlastung der Rentenkassen bei.
Die finanziellen Belastungen der Rentner steigen massiv im Vergleich zu den Aktiven, zum Beispiel durch:
- den vollen Krankenversicherungsbeitrag ab 2004 (abzgl. Freibetrag seit 2020)
- die zunehmende Rentenbesteuerung sowie
- den vollen steigenden Pflegeversicherungsbeitrag
Im Ergebnis werden die Rentner gegenüber den Aktiven durch die volle Sozialversicherungsbeitragslast überbelastet und unterversorgt. Der Bundestag sollte daher den §16 BetrAVG abändern und mindestens
eine jährliche Anpassung an die Geldentwertungsrate oder an die durchschnittlichen Tariferhöhungen für 2020 ff. vorsehen und dadurch den Wert der Zusatzrente sichern.
Ferner sollte die wirtschaftliche Situation aller Zusatzversorgungskassen gutachterlichüberprüft werden, denn diese haben zum Teil seit 2001 ihre Renten aus den Zinseinnahmen gezahlt (z.B. Katholische Zusatzver-sorgungskasse und Emder Zusatzversorgungskasse), so dass inzwischen eine Überkapitalisierung eingetreten sein dürfte. Durch die Zahlung zu geringer Zusatzversorgungsrenten werden zudem die öffentlichen Kassen belastet (Wohngeld, Pflegeheimkosten), obwohl die immer reicher werdenden Zusatzversorgungskassen für eine geldwertstabile Zusatzversorgung ihrer Rentner sorgen könnten.